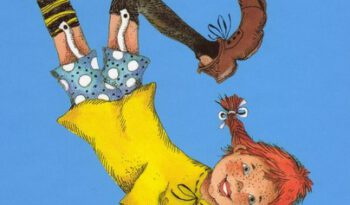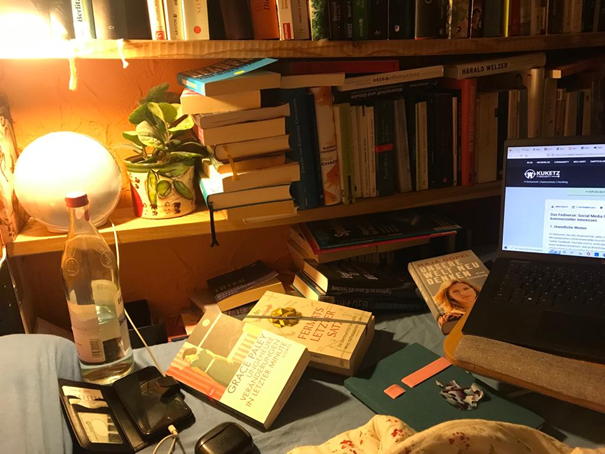“ Es gibt kein Recht der Eltern auf ihre Kinder, es gibt nur das Recht der Kinder auf die Eltern.” Es ist eine provokative These, die meine Patchwork-Mutter damals aufstellte, die sich mir als Kind einbrannte und die ich auch
WeiterlesenAutorenhomepage und Blog